Trotzdem denke ich, man darf durchaus von einer gewissen Schicksalhaftigkeit sprechen, wenn Spieler A ein Monster bei einer Wahrscheinlichkeit von läppischen 10 Prozent gleich im ersten Würfelwurf niederstreckt, während Spieler B nach etlichen Versuchen und trotz Wahrscheinlichkeit von 94 Prozent komplett scheitert, dabei seinen Vorrat an Gunstplättchen verballert und sich obendrein zwei Wunden einfängt.
Das ist nicht schön für Spieler B. Und wenn Spieler B der Rezensent ist, ist das meistens auch nicht so schön für das Spiel.
Wie geht DAS ORAKEL VON DELPHI? Jeder besitzt ein Schiff, mit dem er in einer (in jeder Partie anders gestalteten) Insellandschaft umherschippert. Wer zuerst zwölf Aufgaben erledigt, gewinnt. Dafür müssen Dinge von hier nach dort transportiert, verdeckt liegende Plättchen der eigenen Farbe gefunden und drei Monster umgehauen werden, wofür man vorab etwas Kampfkraft sammeln sollte. Je schwieriger die Aufgabe, desto größer die Belohnung. Früh eine der vermeintlich härteren Aufgaben zu erledigen, kann einen schönen Anschub bedeuten.
Zwei Mechanismen sind zentral: 1. Zum Ende seines Zuges würfelt jeder Spieler drei Farbwürfel, die über seine Aktionsmöglichkeiten im nächsten Zug bestimmen. Weil es ansonsten langweilig wäre, stehen mehr als ein Dutzend verschiedene Aktionen zur Wahl ... wenn die Farbe passt. Um auf ein rotes Meerfeld zu segeln, benötige ich ein rotes Würfelsymbol. Um eine gelbe Statue an Bord zu nehmen, ein gelbes. Unter Einsatz von Gunstplättchen darf ich Würfelfarben ändern.
2. Jeder Spieler besitzt sechs Götterscheiben in den Farben der sechs Würfelseiten. Die Scheiben bewegen sich auf einer „Götterleiste“ vorwärts. Das Voranschieben einer Scheibe ist übrigens eine der möglichen Würfelaktionen. Oft allerdings nicht die beste. Eleganter ist ein anderer Weg: Immer wenn ein Mitspieler seine Würfel neu würfelt, dürfen alle anderen eine der erzielten Farben auswählen und (unter bestimmten Voraussetzungen) die entsprechende Götterscheibe vorrücken. Kommt eine am Ende ihrer Laufskala an, gewährt der Gott dem Spieler eine Gunst. Der sehr beliebte schwarze Gott beispielsweise tötet ein Monster. Mit etwas mehr Engagement für den Kult des Schwarzen hätte Spieler B also einiges gegen seinen Bluthochdruck tun können.
Aber man kann sich ja nicht um alles kümmern. Und genau darin liegt der Reiz von DAS ORAKEL VON DELPHI. Man muss auswählen, Prioritäten setzen, sich fokussieren.
Was passiert? Theoretisch gibt es wahnsinnig viele Optionen. In seinem Zug wählt man aber nur drei davon. Und wenn die Würfelfarben mal wieder nicht optimal gefallen sind, muss man sich entscheiden, zu wie vielen Abstrichen vom Lieblingsplan oder zu wie vielen Zusatzkosten man bereit ist. Und obwohl man sich eine effektive und kurze Route für sein Schiff vorgenommen hatte, kreuzt man dann doch wirr hin und her, weil es die doofen Würfel nicht anders hergeben.
DIE ORAKEL VON DELPHI ist ein Wettlauf. Man häuft keine Güter für eine Schlusswertung an, sondern hat zwölf Aufgaben zu erledigen. Das bringt spielerisch gleich zwei Vorteile mit sich: 1. Man empfindet nicht dieselbe Planlosigkeit wie in anderen komplexen Spielen, was denn nun gut oder schlecht sein könnte. Es ist nämlich ganz einfach: Aufgaben zu erledigen, ist gut. Die Ziele sind also immer klar. 2. Man erlebt immer wieder Teilerfolge. Irgendwas schafft man schon. Irgendwann.
Unbestritten erlebt man auch immer wieder Misserfolge, sogar bis hin zur Frustration. Verglichen mit dem Regelaufwand und der Detailfülle strotzt DAS ORAKEL VON DELPHI nur so vor Zufallsfaktoren: Man kann schlecht würfeln. Oder unpassende Orakelkarten ziehen. Oder die Götterscheiben kleben am Boden. Wunden kommen ungelegen oder zu schnell und zwingen zum Aussetzen. Die gesuchten Plättchen liegen am Ende der Welt. Erhaltene Belohnungen bleiben wirkungslos, weil man durch schlichtes Pech einfach nie die Voraussetzungen erfüllt.
Was taugt es? Ungewöhnlich viele Möglichkeiten, ungewöhnlich viel Schicksal: DAS ORAKEL VON DELPHI fühlt sich ähnlich an wie BRÜGGE. Und BRÜGGE war nie das Spiel, in dem ich mich wohl gefühlt habe. Es hat immer irgendwie genervt ... es hat mich aber auch immer irgendwie angelockt.
Genauso ist es bei DAS ORAKEL VON DELPHI, allerdings ist der Lockfaktor größer. Das liegt einerseits am Wettlauf-Charakter. Es ist schön, zur Abwechslung mal nicht in zehn Kategorien die Punke zu addieren.
Noch reizvoller aber finde ich das variable Spielfeld, in dem ich mich – na ja, theoretisch – völlig frei bewegen kann. Entfernung wird erfahrbar – ein Faktor, der in Brettspielen selten eine Rolle spielt oder stärker abstrahiert wird als hier. In dieser 2D-Landschaft kann ich mir – wieder theoretisch – meine ganz persönliche Route zurechtlegen, um schneller zu sein als die anderen, ihnen auszuweichen oder ihnen auch bewusst etwas vor der Nase wegzuschnappen.
Zum Schluss könnte ich noch erwähnen, dass sich rot und rosa schlecht unterscheiden lassen und dass ich in den ersten Partien etliche kleine Regelfehler gemacht habe. Natürlich ist die Detailfülle schuld. Mangelndes Leseverständnis, von dem ich im Referendariat ebenfalls erfahren habe, betrifft in den vielen pädagogischen Studien nämlich immer nur die Schüler.
DAS ORAKEL VON DELPHI von Stefan Feld für zwei bis vier Spieler, Hall Games.

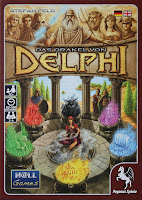



0 Kommentare:
Kommentar veröffentlichen
Aufklärung über den Datenschutz
Wenn Sie einen Kommentar abgeben, werden Ihre eingegebenen Formulardaten (und unter Umständen auch weitere personenbezogene Daten, wie beispielsweise Ihre IP-Adresse) an den Google-Server übermittelt. Mit dem Absenden Ihres Kommentars erklären Sie sich mit der Aufzeichnung Ihrer angegebenen Daten einverstanden. Auf Wunsch können Sie Ihre Kommentare wieder löschen lassen. Bitte beachten Sie unsere darüber hinaus geltenden Datenschutzbestimmungen sowie die Datenschutzerklärung von Google.
Freischaltung von Kommentaren
Ich behalte mir vor, Kommentare nicht freizuschalten, insbesondere Kommentare, die Schmähungen oder Werbung enthalten. An Wochenenden dauert es meist länger, bis ich Kommentare prüfe. Vollkommen anonyme Kommentare haben schlechtere Chancen, von mir freigeschaltet zu werden.