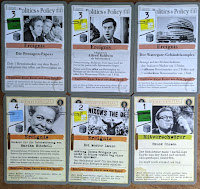Es ist noch nicht so lange her, da hatte ich das Gefühl, vermehrt setze sich die Erkenntnis durch, dass bei Spielen vor allem die schöpferische Leistung zählt. Statt der Kritik „Mit einem Zettel und drei Würfeln könnte ich das auch basteln“ machte man den Wert eines Spiels mehr von der schönen Zeit abhängig, die einem das Spiel bescherte, und weniger vom vermeintlichen Gegenwert des enthaltenen Materials. Seit jedoch immer mehr Spiele per Crowdfunding finanziert werden und ich auf Schachtelrückseiten „18 einzigartige, bemalte Wahrzeichen“ lese, beschleicht mich das Gefühl, diese Zeit ist schon wieder vorbei.
Wie geht TAPESTRY? TAPESTRY ist ein Zivilisationsspiel, dessen Thema nur am Rande durchschimmert. Die meiste Zeit sind wir damit beschäftigt, auf vier Skalen voranzuschreiten. Das kostet Rohstoffe und bringt Fortschritte.
Jede Skala steht für einen anderen Aspekt, wie man Punkte und Rohstoffe sammelt. Beispielsweise erlaubt mir die rote Skala Ausbreitung auf der Landkarte, die gelbe Skala beschert mir Technologie-Karten und deren Aufwertung.
TAPESTRY erfordert Optimierung, um mit den vorhandenen Ressourcen möglichst viele und auch die richtigen Schritte zu schaffen und unterwegs Effekte auszulösen, die dann noch mehr Schritte oder Punkte bringen. Der Motor ist das Einkommenstableau. Je mehr Felder ich hier freischalte, desto höher sind mein Ressourcen-Einkommen und meine Wertungen.
Zu solchen Wertungen kommt es nur viermal im Spiel, und zwar immer bei Aufstieg in eine neue Ära. Mit dem Aufstieg verbunden ist das Ausspielen eine meiner „Gobelin-Karte“, die mir entweder einen Sofort-Effekt oder einen Dauereffekt für die kommende Ära bringt. Erreiche ich die fünfte Ära, endet meine Partie. Meine Mitspieler*innen spielen weiter, bis auch sie in der fünften Ära ankommen.
Was passiert? TAPESTRY dauert recht lange; zu viert sollte man drei Stunden einkalkulieren. Angesichts dieser Spieldauer und auch der Interaktionsarmut überraschen die zahlreichen Glücksfaktoren. Manche Entscheidungen werden schlicht ausgewürfelt. Es gibt Gobelin-Karten, die gerade gar nichts nützen, und dann wieder andere, die einen fantastischen Boost bescheren.
Jede*r Spieler*in verkörpert eine von 16 möglichen Zivilisationen mit Spezialregeln. Und wie das so ist: Die eigene Eigenschaft wirkt zu schwach, die der Nachbarn superstark. Ungewöhnlicherweise liefert TAPESTRY den Beweis der Unausbalanciertheit auch gleich mit: Meinem Exemplar liegt ein Regel-Update für acht der Zivilisationen bei und im Netz konnte ich bereits ein zweites Update für noch mal drei Zivilisationen finden. Die meisten Zivilisationen sind auch nicht auf die Mitspieler*innenzahl angepasst, obwohl ich den Eindruck habe, dass das bei einigen durchaus einen Unterschied macht.
Mir ist klar, dass man ein Spiel nie zu 100 Prozent durchtesten kann, weil es nach der Veröffentlichung zwangsläufig von viel mehr Menschen und viel häufiger gespielt wird als vorher. Wenn allerdings in einem Ausmaß Anpassungen nötig werden wie in TAPESTRY, habe ich den Eindruck absichtlicher Nachlässigkeit. Die Community wird’s schon richten.
Wenn obendrein die speziell beworbenen „18 einzigartigen, bemalten Wahrzeichen“ kaum ins Spiel eingebunden sind und sogar eher stören, ärgert mich das sehr. Eine der Punktwertungen zielt darauf ab, dass ich mein Hauptstadt-Tableau vollpuzzle. Die größte Fläche dabei bedecken die Wahrzeichen, die ich immer dann erhalte, wenn ich auf einer Skala bestimmte Felder als Erster erreiche. Zu mehr werden die Dinger tatsächlich nicht gebraucht. Ansonsten stehen sie im Weg rum, erschweren die Übersicht und passen nicht einmal deckungsgleich auf die Hauptstadtfelder. Sie sind für ihren gedachten Zweck grotesk ungeeignet. Wäre an dieser Stelle alles gesagt, wäre TAPESTRY ein klarer Fall für das Label „misslungen“.
Doch TAPESTRY hat auch große Qualitäten. Die elegant verzahnte Optimiererei an sich macht schon Spaß: der Versuch, aus der eigenen Zivilisation möglichst viel herauszuholen, das Erforschen, welche Vorgehensweisen erfolgreicher als andere sind, das Experimentieren, indem man die Prioritäten mal so und mal anders setzt.
Nicht mal die heftigen Glücksmomente finde ich störend. Dass es starke Karten und gute Würfelwürfe gibt, bringt Hoffnung und Emotionen ins Spiel. Es ist nicht alles trockene Rechnerei. Es gibt auch so etwas wie Schicksal und man muss seine Spielweise daran anpassen.
TAPESTRY ist weniger kanalisiert als typische Eurogames und traut sich auch Extreme. Die zahlreichen Zivilisationen und Gobelin-Karten können sich gegenseitig und damit die Partie überraschend beeinflussen, und in ihrer Gesamtheit sind die vielen möglichen Kombinationen unvorhersehbar. Immer wieder kommt es zu Situationen, die es in Partien zuvor noch nicht gegeben hat. Auf der einen Seite stört dann wieder, dass uns die Anleitung in Spezialfragen alleine lässt. Auf der anderen Seite verblüfft TAPESTRY beim Spielen durch das, was passiert. Es ist ein bisschen wie eine Wundertüte.
Was taugt es? Ich finde einiges in TAPESTRY auf ärgerliche Weise misslungen, anderes sehr reizvoll. Im Mittel nenne ich das jetzt mal „solide“, obwohl gerade diese Bezeichnung überhaupt nicht zu TAPESTRY passt.
Ich halte TAPESTRY für nicht komplett ausgereift und hätte mir mehr Feintuning und weniger Details gewünscht, mehr Zweckmäßigkeit und weniger Show. Doch die Verkaufszahlen geben der Verlagsstrategie recht. Anscheinend sind „18 einzigartige, bemalte Wahrzeichen“ mittlerweile vielen Menschen wichtiger als redaktionelle Perfektion.
**** solide
TAPESTRY von Jamey Stegmaier für eine*n bis fünf Spieler*innen, Feuerland.