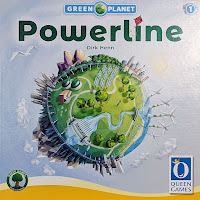Neulich las ich in einem ganz tollen Artikel, der Würfelturm sei bei Queen Games zu einem wiederkehrenden Element geworden. Und was soll man sagen … hier ist er mal wieder!
Neulich las ich in einem ganz tollen Artikel, der Würfelturm sei bei Queen Games zu einem wiederkehrenden Element geworden. Und was soll man sagen … hier ist er mal wieder!
Wie geht MARRAKESH? Zwölf verschiedene Farben sind bestimmten Aktionen zugeordnet. Eine Aktion fällt stärker aus, je mehr Pöppel (die Anleitung sagt: „Keshis“) der entsprechenden Farbe ich gesammelt habe. Beispielsweise liefern wir uns ein Wettrennen auf dem Fluss, und die blaue Aktion bringt mein Boot voran: pro blauem Keshi ein Feld. Oder: Wir brauchen Waren, und die grüne Aktion bringt mir pro grünem Keshi eine Dattel.
Die meisten Aktionen sind etwas umfangreicher als diese beiden Beispiele. Gemeinsam ist ihnen, dass sie auf verschiedene Arten Punkte oder Rohstoffe bringen. Oder weitere Keshis. Oder ich schalte mir Schlusswertungen oder Dauervorteile frei, sodass bestimmte Aktionen bei mir mehr abwerfen als normalerweise.

In jedem der drei Durchgänge starte ich mit je einem der zwölf Keshis hinter meinem Sichtschirm. Für jede Runde wähle ich geheim drei davon. Ihre Farben besagen, welche Aktionen ich ausführen werde. Nur der rote Keshi erlaubt mir eine Aktion meiner Wahl. Das bedeutet: Im Laufe jedes Durchgangs werde ich jede Aktion mindestens einmal ausführen und nur eine Aktion zweimal.
Alle gewählten Keshis wirft irgendwer in den Würfelturm. Die meisten fallen unten wieder heraus, eventuell kommen auch noch Keshis früherer Runden zum Vorschein. Reihum nehmen wir davon nun bis zu zwei Keshis einer Farbe, bis alles verteilt ist. Diese Keshis kommen nicht wieder hinter den Sichtschirm, sondern auf unsere Tableaus, und definieren – siehe oben –, wie viel mir die zugehörige Aktion bringt.
Übrigens muss ich nicht zwangsläufig die Keshis nehmen, die zu meiner gewählten Aktion passen. Vielleicht besitze ich schon so viele Datteln, dass mir die Aufwertung des grünen Bereichs nicht so wichtig ist. Und statt grünem Keshi nehme ich nun lieber einen braunen, weil der für die Zukunft interessanter erscheint und weil es die Mitspieler:in mit der braunen Aktion so schön ärgert.

Was passiert? Jede Aktion muss mindestens dreimal während der Partie gewählt werden. Das System von MARRAKESH zwingt mich dazu, dass ich alles ein bisschen mache. Aber das ist fürs Vorankommen nicht optimal; außerdem zählt jede Aktion, die ich auf das Maximum von neun Keshis aufgewertet habe, am Ende noch mal ordentlich Extrapunkte. Ich versuche also, Schwerpunkte zu setzen, indem ich mir zusätzliche Keshis bestimmter Farben verschaffe: entweder als Ertrag meiner Aktionen oder indem ich die mir wichtigen Farben (mit der Spekulation auf gleichfarbigen Beifang) in einem hoffentlich günstigen Moment in den Turm gebe: wenn ich Startspieler bin und zuerst wähle oder wenn ich vermute, dass die anderen sich für andere Farben interessieren.
Schön für das Spielgefühl ist aber, dass ich in jedem Fall vorankomme. Alles hilft. Falls mir eine Aktion mangels Keshis zu schwach erscheint, kann ich auf die Aktion verzichten und ersatzhalber einen Keshi nehmen, was gar nicht so schlecht ist, wie es zunächst erscheinen mag. Zweifellos gibt es auch ärgerliche Momente. Wer bei der Turmverteilung hinten sitzt, bekommt üblicherweise einen oder zwei Keshis weniger ab als der / die Startende, und kann nur hoffen, dass sich das später wieder ausgleicht.
Schön für das Spielgefühl ist auch die klare Orientierung. Dass wir regelmäßig Abgaben zahlen müssen, ist zwar nicht originell, aber es definiert Etappenziele. Innerhalb von vier Runden will ich bestimmte Güter erwirtschaften. Bei all den vielen verschiedenen Farben und den damit verbundenen vielen Einzelregeln ist das ein guter Leitfaden. Dass ich bis Spielende einige Farben maximieren will, setzt zudem ein übergeordnetes Ziel.
Die Güter zu beschaffen, ist gegen Ende meist gar nicht mehr so schwierig. Ob ich Farben komplettieren kann, entscheidet sich aber oft erst kurz vor Schluss, was MARRAKESH bis zum Finale sehr spannend macht.
Der Einstieg jedoch verläuft zäh. Mehr als 100 Plättchen mit recht viel Symbolsprache sind im Spiel, alle unterschiedlich. Vieles kann man sich herleiten, und das Glossar listet auch jeden Effekt gut auf. Trotzdem stockt das Spiel, wenn wieder ein neues Plättchen auftaucht, das erklärt oder zu einem späteren Zeitpunkt in Erinnerung gerufen werden muss.

Was taugt es? MARRAKESH ist ein typisches Eurogame mit aufgesetztem Thema. Weil es MARRAKESH heißt, sind eben Datteln und Oasen und ein Kamel dabei. Das hat nichts weiter zu bedeuten; es sind nur Abbildungen und Benennungen. MARRAKESH erhebt aber auch keinen thematischen Anspruch. Es geht um den Mechanismus.
Und der macht Spaß. Gerade weil so viele Aktionsfarben im Spiel sind, bin ich nicht gezwungen, dieselbe Tour zu spielen wie die anderen Spieler:innen. Und obwohl man viel rechnen kann und teilweise auch muss, ist das Spielgefühl eher locker. Die Glücksfaktoren sind unübersehbar: Was aus dem Turm fällt und was steckenbleibt, kann einen großen Unterschied bedeuten. Oder welche Plättchen im Angebot sind. Zu Beginn hoffe ich, starke Dauereffekte erwerben zu können, gegen Ende starke Einmaleffekte. Auch die Sitzreihenfolge hat Einfluss. Ist die blaue Aktion erst mal ordentlich aufgewertet, kann die Flussfahrt nach nur zwei Zügen entschieden sein; und von Zweien, die das Potenzial haben, das Zielfeld zu erreichen, sichert sich Platz eins der / die zuerst Ziehende.
Die verschiedenen Aktionsfarben sind wie viele kleine Spiele, die zusammen ein großes Spiel ergeben, was mich an TRAJAN erinnert. Mit seiner Mischung aus Planung, Optimierung und Überraschung enthält MARRAKESH am Ende so viele Elemente, dass das, was ich als den Kern verstehe (das Aufwerten von Aktionen) gar nicht mehr so sehr im Zentrum steht. MARRAKESH ist wie ein bunter Eintopf mit sehr vielen Zutaten.
Vermutlich sollte das auch genau so sein: mal nicht reduzieren, sondern an Plättchen und Material und Regeln reinhauen, was geht. Beim Material hat das für mich einen schlechten Beigeschmack. MARRAKESH benötigt einen sehr großen Tisch und wirkt überproduziert. Die Double-Layer-Boards tragen wenig dazu bei, das Thema zu unterstützen, das Spiel zu ordnen und übersichtlich zu machen. In erster Linie sind sie wuchtig.
Und der Effekt des Würfelturm ist gering. Ich hatte Partien, in denen über viele Runden exakt alles so wieder herauskam, wie es eingeworfen wurde. Erst wenn man die Wurftechnik etwas verändert, bleibt mehr stecken. Aufwand und Ertrag des Turms stehen in einem fragwürdigen Verhältnis.
***** reizvoll
MARRAKESH von Stefan Feld für zwei bis vier Spieler:innen, Queen Games.