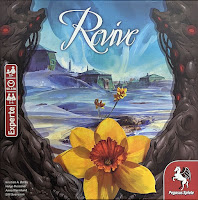Hex, Katz, bärtig
Hex, Katz, bärtig
Einleitung ist fertig
Wie geht HEISSE HEXENKESSEL? Wir versuchen, der Person rechts von uns mehr Zutaten zuzuschanzen, als sie in ihrem Vorrat unterbringen kann. Hat meine Nachbarhexe fünf überschüssige Zutaten gesammelt, gewinne ich.
Die Zutaten sind Holzwürfel in den Farben rot, blau, grün, weiß und schwarz. (Man könnte auch stimmungsvoller sagen: Es sind Pilze, Spinnen, Kröten, Alraunen, Schattenherzen.) Jede Runde spielt jede:r eine von vier Rezeptkarten aus der Hand. Jede Rezeptkarte definiert ein Tauschverhältnis und besagt beispielsweise, ich muss zwei weiße Würfel einsetzen, um damit drei blaue Würfel herzustellen.
Alles, was ich hergestellt habe (in diesem Fall drei blaue Würfel), schiebe ich am Ende der Runde nach rechts. Meine Nachbarhexe muss es, wenn möglich, in ihren Bestand nehmen. Alles, was ich eingesetzt habe, geht verloren. Was meistens gar nicht schlecht ist, denn ich will ja nicht, dass meine Vorräte überlaufen.

Nun werden die Handkarten nach links weitergegeben, eine nachgezogen, wieder eine ausgespielt. Nach der zweiten Runde hat man also zwei Rezepte im Spiel, nach der dritten drei und so weiter. Und soweit der eigene Zutaten-Vorrat reicht, wird man üblicherweise auch alle Rezepte ausführen, um möglichst viel Zeug nach rechts rüberschieben zu können.
Reicht der Vorrat nicht aus, darf man auch Zutaten, die man im selben Zug hergestellt hat, benutzen, um die Voraussetzungen anderer Rezepte zu erfüllen. Das ist meist besser, als komplett auf die Ausführung des Rezepts zu verzichten. Aber natürlich ist es ärgerlich, denn man hätte auch diese Steine lieber der Nachbarhexe reingedrückt.

Was passiert? HEISSE HEXENKESSEL endet ziemlich schnell. Die meisten meiner Partien gingen nur über vier Durchgänge. Selten wurden es mal fünf. Mehr habe ich kein einziges Mal erlebt, obwohl ich HEISSE HEXENKESSEL in verschiedenen Runden mit unterschiedlicher Teilnehmer:innenzahl und sowohl mit Neuspieler:innen als auch Wiederholer:innen gespielt habe.
Und vier Runden, selbst fünf, empfinde ich als zu kurz. Bei irgendwem entsteht recht schnell in irgendeiner Farbe ein Überschuss, sagen wir in Blau. Und es ist auch nicht so, dass man das verpennt oder ignoriert: Man sieht das Unglück kommen, aber man bekommt eben nicht die Rezepte, um nennenswert blaue Zutaten loszuwerden. Und wenn die Person links ihre Produktion blauer Zutaten sogar noch steigern kann, ist man ruckzuck am Ende, und ich frage mich: Wozu der ganze Aufwand? Wo ist da der Spannungsbogen?
Ich erlebe in HEISSE HEXENKESSEL auch keine Abwägung zwischen Offensive und Defensive. Offensive ist klar am besten. Ob ich mein Zutatenlimit etwas überschreite, ist egal, Hauptsache, ich mache meine rechte Nachbarhexe platt.

HEISSE HEXENKESSEL geht erst dann über mehr Runden, wenn wirklich alle am Tisch die Züge durchrechnen und registrieren, dass da jemand kurz vorm Absaufen ist, und versuchen, der Person, die dann gewinnen würde, Zutaten gezielt vorzuenthalten. Man braucht dann eine Regelung, wer seine Rezepte im Zweifelsfall zuerst ausführen muss, und über Initiativwerte der gespielten Karten gibt es eine solche Regelung auch.
In meinen Runden wurde davon aber kein Gebrauch gemacht. HEISSE HEXENKESSEL wurde als schnell gespieltes Ärgerspiel verstanden, und es gab auch einige Spieler:innen die mit der kurzen Spieldauer und dem, was währenddessen passierte, völlig zufrieden waren.
Was taugt es? Vom Prinzip her gefällt mir HEISSE HEXENKESSEL. Man spielt nicht nebeneinander her, sondern steht im direkten Duell mit den beiden Nachbar:innen. Von links kommt lauter Übles, nach rechts möchte man möglichst viel Übles weitergeben. Mir gefällt die Aufmachung des Spiels und mir gefällt auch die Schadenfreude.
Für mein Empfinden ist das Spiel aber zu kurz. Es baut sich keine Spannung auf, sondern die Dinge geschehen einfach, brechen über die Opfer herein. Dass hier redaktionell nicht alles rund ist, zeigen mir auch die bislang nicht erwähnten Arkana-Effekte, die für wenig Auswirkung sehr viel Erkläraufwand verursachen – und beim Spielen (vielsagenderweise) dann doch ständig vergessen werden.
*** mäßig
HEISSE HEXENKESSEL von Erik Andersson Sundén für zwei bis fünf Spieler:innen, Leichtkraft / AEG.